1950er bis 1960er Jahre
Vom Neuanfang zur Spitzenorganisation


Erste Vorgespräche für eine bundesweite Gewerkschaftsgründung finden im Frühjahr 1950 zwischen den Vertretern der Polizeiverbände der britischen Besatzungszone und West-Berlin statt. Am 14. September ist es soweit: Die GdP (Bund) wird in Hamburg gegründet. Zum ersten Vorsitzenden wird Fritz Schulte – seit 1948 Vorsitzender des „Bundes der Polizeibeamten des Landes Nordrhein-Westfalen“ – gewählt. Ebenso wie sein niedersächsischer Stellvertreter, August Henn, kann Schulte auf Erfahrungen aus seiner Zeit beim Schrader-Verband zurückgreifen.
Die bereits bestehenden Verbände der einzelnen Länder werden in Landesverbände der GdP umgewandelt und organisieren gemeinsam rund 42.500 Mitglieder. Schon im Folgejahr gelingt es, neue Landesbezirke in Hessen und Rheinland-Pfalz zu gründen.
Die Besatzungsmächte hinterlassen in ihren Einflussbereichen äußerst unterschiedliche polizeiliche Strukturen. So sind Polizisten in West-Berlin ausschließlich Angestellte.
Eine der ersten Forderungen der jungen Gewerkschaft bildet daher die Vereinheitlichung der Polizei und deren Überführung von kommunaler in staatliche Hand. Zugleich nutzt sie die Ausgangssituation, um von Beginn an alle Polizeiangehörigen zu organisieren.
Denkschrift zur Besoldungsreform
Auf ihrem ersten Ordentlichen Delegiertenkongress 1951 in Koblenz wird die Neuordnung des Besoldungswesens als Hauptforderung formuliert. Der Bruttoverdienst eines Polizeihauptwachtmeisters beläuft sich zu dieser Zeit auf gerade einmal 305,50 Deutsche Mark (DM) und reicht damit kaum, um eine Familie zu ernähren. Der Forderung wird während des gesamten ersten Jahrzehnts immer wieder Ausdruck verliehen und führt mehrfach zu zeitgemäßen Anpassungen – so 1951 mit dem „Gesetz zur Änderung und Ergänzung des Besoldungsrechts“, 1954 mit der GdP-Denkschrift zur Besoldungsreform, der Besoldungsreform von 1957 und dem neuen Beamtenrechtsrahmengesetz. Auf diesem ersten, der nunmehr jährlich stattfindenden Kongresse, wird ebenfalls ein Entwurf für einheitliche Laufbahnvorschriften vorgelegt, der die Basis für die Einheitslaufbahn bildet.
Eine der wichtigsten Lehren aus dem Scheitern der Weimarer Republik ist, dass Polizisten künftig auf das neu geschaffene Grundgesetz und nicht auf die jeweilige Regierung vereidigt werden. Damit werden nicht nur die Abwehrkräfte des Staates gegen extremistische Bestrebungen gestärkt, sondern der Grundstein für eine moderne Polizei gelegt. Auch die GdP setzt sich in diesen ersten Jahren mit dem Verhältnis zwischen Staat, Bevölkerung und Polizei auseinander. Anlass gibt unter anderem die Gründung des Bundesgrenzschutzes (BGS), dessen damalige, paramilitärische Organisation von der Gewerkschaft stark kritisiert und abgelehnt wird. Ihr Einsatz zeigt Erfolge: 1952 wird die Polizei nach GdP-Protesten zuerst in Nordrhein-Westfalen, nach und nach auch in den anderen Ländern als zivile Organisation verstaatlicht.
Mit ihrer Zeitung DEUTSCHE POLIZEI (DP) informiert und kommuniziert die GdP seit 1952 mit ihren Mitgliedern. Auch die polizeilichen Aufgaben wachsen in dieser Zeit.
Das aufkeimende Wirtschaftswunder treibt die Automobilität voran und lässt auch die motorisierte Polizei an Bedeutung gewinnen.

Erster Schritt nach Europa

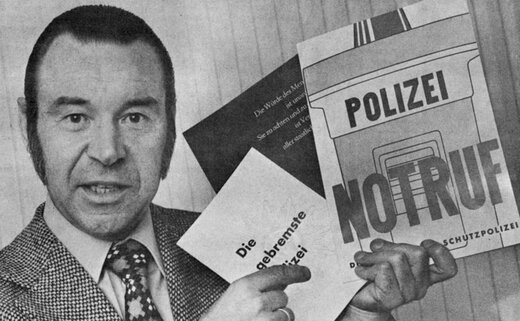
Mit dem Beitritt zur „Union Internationale des Syndicats de Police“ (UISP) 1955 betritt die GdP erstmals internationales Parkett. Dieses Jahr steht zudem im Zeichen einer Protestwelle. In 20 Städten protestieren insgesamt 26.000 Mitglieder. Die Protestwelle hält bis ins folgende Jahr an und wird schließlich mit der Höhergruppierung des Mittleren Dienstes belohnt.
1956 tritt Fritz Kehler die Nachfolge des verstorbenen Schulte an. Auf ihn folgt zwei Jahre später Werner Kuhlmann, unter dem die GdP 1959 offiziell nach dem Bundesbeamtengesetz als Spitzenorganisation anerkannt wird und ihren Einfluss damit erheblich erweitert.
