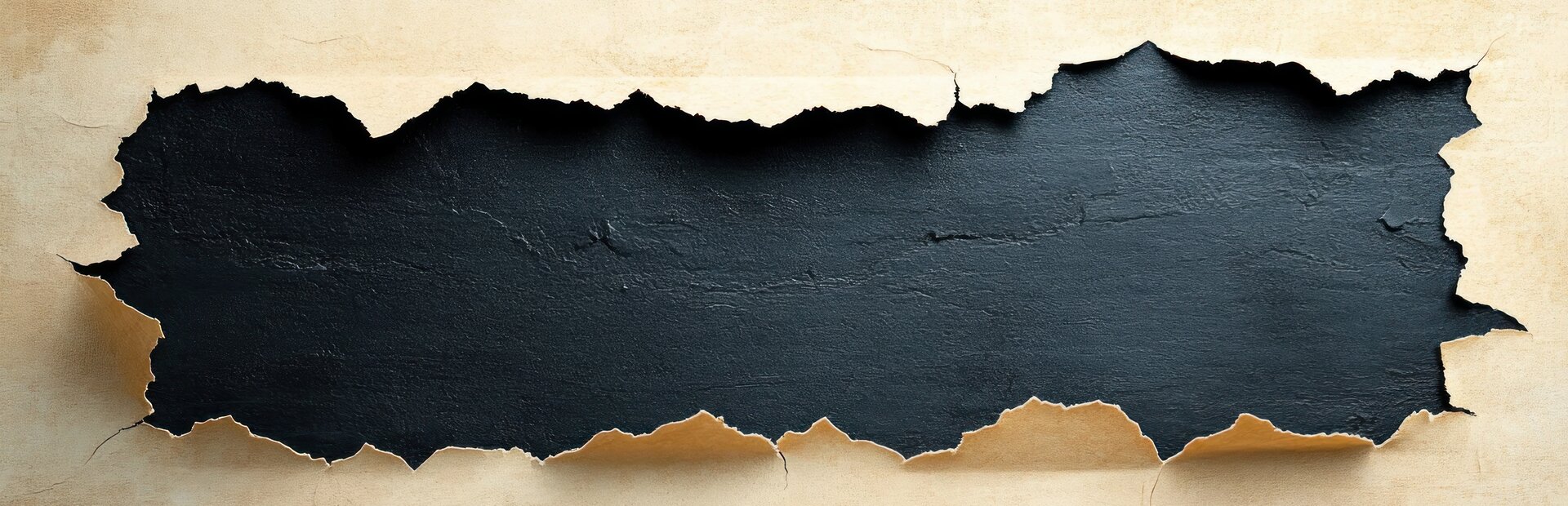
zong/stock.adobe.com
04.05.2025
GdP weist Drohungen gegen Beschäftigte des Verfassungsschutzes durch AfD-Funktionär zurück
Innenpolitik
Demokratie
Meldungen

Koalitionsvertrag: GdP-Chef im Gespräch mit der Süddeutschen
Innenpolitik

Kopelke: Lagebewältigung gelingt nur mit starken Polizeikräften
Innenpolitik

Hüber: Tarifergebnis muss auf Beamte übertragen werden
BeamtenpolitikTVöD 2025

Kopelke: Internationale Anerkennung für Kampf gegen Antisemitismus in Deutschland
Antisemitismus

Mertens: Coole Autos sind okay, illegale Manipulationen und Autorennen nicht
Verkehr

Podcast mit GdP-Chef Kopelke: Wir leisten uns eine demokratische Gesellschaft
AnwärterPKS

Koalitionsvertrag: GdP-Vize Sven Hüber zu Asyl und Migration
EuropaSicherheitspolitik

TVöD-Einigung: Vertretbarer Kompromiss
TarifverhandlungenTVöD 2025
Impulspapier zur Bundestagswahl 2025
Mitglied werden
Tarifrunde 2025
Meldungen aus den Ländern und Bezirken

Zunehmende politisch motivierte Straftaten: Polizei zieht sich weiter aus der Fläche zurück
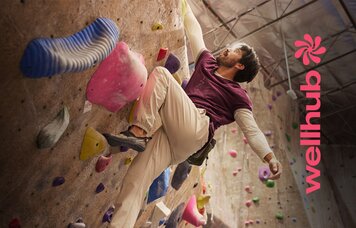
Wellhub: Neu und exklusiv für GdP-Mitglieder!
Mitgliedervorteile

Historische Ehrung für GdP-Landesjugendvorsitzenden
JUNGE GRUPPE (GdP)BG Mannheim

Lokale Präsenz, Quattro-Streife und Kriminalassistenten – Erfolgsmodelle mit Nachbesserungsbedarf
TarifpolitikInnere Sicherheit

Interview zur gescheiterten Migrationspolitik: live im SWR - mit Sinan Toksoy
JUNGE GRUPPE (GdP)BG Stuttgart

Update: Langzeitkonten – wie geht es weiter?
Arbeitszeit

GdP Hamburg: Hamburger Polizei wird pauschal unter Extremismusverdacht gestellt!
PressemitteilungenInnere Sicherheit

Bundestagsbeschluss zum Mutterschutz
GdP
Länder & Bezirke
Alle Landesbezirke und Bezirke auf einen Blick.
Frauengruppe
JUNGE GRUPPE (GdP)
Seniorengruppe
